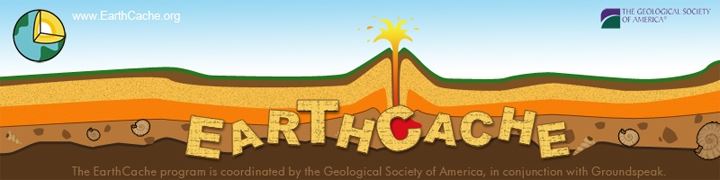Schloss Herzberg - Die geologische Grenze des Harz
Einleitung
Schloss Herzberg ist eine Schlossanlage in Herzberg am Harz. Die heutige Vierflügelanlage hat ihren Ursprung etwa im 11. Jahrhundert als mittelalterliche Burg. Nach einem Brand im Jahr 1510 wurde sie als Schloss neu aufgebaut und ist eine der wenigen Schlossanlagen Niedersachsens, die in Fachwerkbauweise errichtet wurden. Wegen der über 700 Jahre langen Zugehörigkeit zum Adelsgeschlecht der Welfen wird die Anlage auch als Welfenschloss Herzberg bezeichnet.
Begebt euch an die angegebenen Koordinaten, beantwortet die folgenden Fragen und schickt uns hier die Antworten.
Ihr dürft gleich loggen, wenn es Probleme gibt dann melden wir uns.
Schön wäre es, wenn ihr auch ein Bild von euch / eurem GPS und den Felsklippen im Hintergrund hochladen würdet.
Fragen:
1. Nenne uns neben den vier im Listing erwähnten Karsterscheinungen zwei weitere typische Phänomene der Karstlandschaft.
Begebt euch nun zum WP 2, hier seht ihr eine Subrosionssenke direkt an der Schlossmauer.
2. Schätzt die Breite Dieser vom Zaun bis zur Mauer.
(Das Grundstück muss dafür nicht betreten werden!)
Begebt euch nun zum WP 3, auf dem Schild seht ihr einen Querschnitt des Schlossberges. Vor den einzelnen Schichten stehen die erdgeschichtlichen Entstehungsperioden.
(Auf dem Weg dorthin kommt ihr an einer schönen Stelle vorbei, wo man den Abgang des Berges gut erkennen kann, diese haben als WP2 (Abhang) mit angelegt.)
3. Nenne uns die beiden Zeitperioden, die am meisten vorkommen!
(Als WP4 haben wir euch einen schönen Standort rausgesucht, an dem ihr einen guten Blick auf den Ochsenpfuhlteich habt.)
Der Teich hat einen gemittelten Durchmesser von ca. 120m.
4. Wie groß ist der Umfang des Erdfallsees?
5. Wie groß ist die Oberfläche?
Die geologische Problematik des Schlossberges
Der geologisch-geomorphologische Rahmen: Schloss Herzberg sitzt dem nordöstlichen Sporn des langgestreckten Schlossberg-Rückens auf. Mit 279 m ü. NN liegt der Schlosshof etwa 50 m über dem breiten, nordwärts angrenzenden Siebertal und der westlichen Innenstadt von Herzberg. Die nördlichen und nordöstlichen, dicht bewucherten Berghänge sind mit 40 - 50° Neigung außerordentlich steil. Am Nordabbruch verbergen sich im dichten Hangwald einige kleine, brüchige Felstürme und eine wenige Zehn Meter lange, bis 20 m hohe Felswand aus sog. "Hauptdolomit" oberhalb des Mühlengrabens.

Am hier besonders steilen Schlossberg-Nordhang werden etwa 10m hohe "Hauptdolomit"-Felsen durch engständige, klaffende Klüfte vertikal zerteilt. Diese kleinen Felstürme haben sich durch die Subrosion im Untergrund, entgegen ihres ursprünglichen geologischen "Einfallens" in den Berg hinein, deutlich talwärts geneigt. Sie drohen, irgendwann abzurutschen oder umzustürzen.
Die Umgebung
350 m südöstlich vom Schloss versteckt sich in einer flachen Senke der versumpfende Ochsenpfuhl-Teich. Er erreicht offenbar nur eine Wassertiefe von wenigen Metern. Sein geringfügig schwankender Spiegel liegt bei etwa 224 m und befindet sich somit wenige Meter unter dem Bett der Sieber, 550 m nördlich an der B243-Brücke. Der fast 7 ha große Jues-See, 0,7 km östlich vom Ochsenpfuhl bzw. 1 km östlich vom Schloss innerhalb von Herzberg gelegen, weist eine (leicht angestaute) Spiegelhöhe von 240,7 m bei einer Wassertiefe von maximal 28 m auf. Diese ungewöhnliche Oberflächengestalt etwa 2 km vor dem südwestwärts abtauchenden Harz-Gebirgskörper weist auf eine junge, noch andauernde geomorphologische und hydrogeologische Aktivität im unmittelbaren Vorland des verfalteten "alten Gebirges" hin.

Die geologische Grenze
Es manifestiert sich hier eindrücklich eine geologische Grenze, die den Harzwest- bzw. -südrand von Seesen über Osterode, Herzberg, Walkenried und Rottleberode schlussendlich bis zum Mansfelder Becken markiert. Hier lagern, im heutigen Abtragungszustand des sog. Deckgebirges, die im Untergrund des Pöhlder Beckens etwa 200 m "mächtigen" (= dicken) Schichten der Zechsteinzeit (vor etwa 250-270 Millionen Jahren) dem "alten Gebirge" auf. Es handelt sich im Raum Herzberg dabei um einen Schichtstapel aus zwei je mehrere Zehner Meter mächtigen Dolomitabfolgen, zwischen denen ein Anhydritkörper stark wechselnder Dicke eingelagert ist. An der Basis befindet sich der sog. "Zechsteinkalk" (bzw. -dolomit). Ihm folgt der oberflächennah in Gips (CaSO4 · 2H2O) umgewandelte "Werraanhydrit" (Anhydrit: CaSO4) der von der etwa 40 m mächtigen Platte des "Hauptdolomit" überdeckt wird. Letztere bildet die Steilkanten des Schlossberges. Der Werraanhydrit befindet sich im Schlossberg-Sockel.

Dieser dreifach überhöhte und etwas geknickte Schnitt durch den Schlossberg von der Sieber über den Mühlengraben (M) im Norden zum Ochsenpfuhl (E) im Südosten des Schlosses stellt seinen geologischen Bau dar. Man erkennt die Schotterfüllung (S) der Siebertalaue und beidseits vom Ochsenpfuhl, die Verkarstung des "Werraanhydrits" (WA), die Klüfte, Höhlen (schematisch angegeben) und sich talwärts neigenden Randbereiche der "Hauptdolomit" (HD)- Platte unter dem Schloss. Schlängelpfeile geben schematisch den Weg der Sickerwässer an. Gerissene Pfeile weisen auf die tendenzielle Hangzerreißung hin, DB = Bahnlinie.
Der geologische Aufbau der Umgebung
Dolomitfels ist in geringem, Anhydrit und Gips hingegen in recht hohem Maße (bis etwa 2 g CaSO4/l) wasserlöslich. Die spröden Dolomitschichten wurden im Zuge der Heraushebung und Verkippung des Harzes (hier ca. 5° nach SW) engständig zerklüftet. Dadurch kann die - geologisch gesehen rasche - Auflösung dieser Zechsteinschichten nicht nur nahe der Geländeoberfläche, sondern auch in Tiefen von vielen Metern, als sog. Subrosion, erfolgen. Subrosion bezeichnet in der Geologie die unterirdische Auslaugung und Verfrachtung von meist leichtlöslichem Gestein. Ihr gegenüber steht die Erosion, die Abtragungs- und Verlagerungsprozesse an der Erdoberfläche beschreibt. Dabei bildet sich durch die sog. Verkarstung eine typische Landschaft mit Höhlen, erweiterten Felsspalten, Erdfällen, Dolinen usw. heraus.
Die Sieber - mit einem Einzugsgebiet von 84 km² im niederschlagsreichen Harz oberhalb von Herzberg – erzeugt eine besonders intensive Verkarstung der Anhydrit- und Dolomitschichten. In Verbindung mit einer Tieferlegung der Landoberfläche um bis zu mehrere Meter durch "Subrosion" gestaltet diese Verkarstung die hiesige Zechstein-Landschaft seit den Eiszeiten wesentlich mit. Große Mengen besonders von Sieber- und Oderwasser versickern durch den klüftigen, karstigen Zechstein und strömen durch den Untergrund des Pöhlder Beckens innerhalb von 2-3 Tagen der Rhumequelle zu. Diese große Karstquelle (160 m ü. NN) liegt 7 km südlich von Herzberg und knapp 70 m unter dem Herzberger Sieberbett. Dabei unterströmt ein großer Teil des Sieberwassers den klüftigen, offensichtlich von Höhlensystemen durchzogenen Werraanhydrit und Zechsteinkalk im Untergrund des Herzberger Schlossberges.
 Geologischer Querschnitt Herzberg-Nordwest zwischen westlichem Schlossberg, Eichholz und der Mahnte
Geologischer Querschnitt Herzberg-Nordwest zwischen westlichem Schlossberg, Eichholz und der Mahnte
Dicht vor dem Steilhang des westlichen Schlossberges, nahe des Herzberger Bauhofs, wurden etwa 25 m derartiger Flusskiese erbohrt. Aus diesem gut durchlässigen, weitgehend grundwassergefüllten Schotterkörper heraus erfolgt auch heute noch auf großer Fläche eine Auflösung der Zechsteinschichten. Daher ist der nördlicheSchlossberghang so steil und mit Erdfällen und kleinen Hangrutschen garniert, da seine Basis andauernd langsam durch Lösung südwärts zurückweicht.
Dort, wo Zechsteinschichten das Sieberbett unterlagern, bildeten sich gelegentlich durch unterirdische Dolomit- und Anhydrit-Auflösung Erdfälle und Subrosionssenken bzw. Dolinen, die schon während ihrer Entstehung durch Kiesmassen verfüllt wurden und somit oberflächlich nicht in Erscheinung treten.
Die Subrosionssenken des Jues-Sees und des Ochsenpfuhls entgingen dieser Auffüllung, da sie erst entstanden, als sich die Sieber in ihr heutiges, weiter nördlich verlaufendes Bett verlagert hatte.

Der geologische Aufbau des Schlossberges
Die Kellerfundamente sitzen mindestens teilweise dem zwar klüftigen aber festen Dolomitfels auf. Im ursprünglichen Zustand dürfte der Schlossbergsporn bis zu einige Meter dick durch Zechstein-Verwitterungsprodukte und Lösslehm überdeckt gewesen sein. Vielleicht lag unter dem Löss auch noch etwas früheiszeitlicher Schotter eines Ur-Sieberlaufes, der westlich anschließend die sog. Hauptterrasse bildet.
Weit ungünstiger ist die Gesamtsituation des Burgbergsporns unterhalb der Fundamente. Er ist durch die tiefgründige Verkarstung und Subrosion des unter seinem Sockel lagernden "Werraanhydrit" als auch der "Hauptdolomit"-Platte, die seine Hänge bildet, grundsätzlich destabilisiert.
Das Kluftsystem, welches die Dolomitschichten netzartig zergliedert, fördert das talwärtige Abkippen bzw. Abrutschen von randlichen Felspartien. Zugleich gleitet die gesamte ca. 40 m dicke und an ihrer Oberfläche nur etwa 100 m breite Felsplatte sehr langsam in Richtung der Steilhänge auseinander. Diese Hangzerreißung wird begünstigt durch eine bis 1 m dicke Tonlage, die als "Rotbrauner Salzton" den "Werraanhydrit" vom "Hauptdolomit" trennt. Dort, wo Dolomitfelsen aus dem Nordhang heraustreten, zeigen sie - entgegen ihrer geologischen Lagerung - eine deutliche nordwärtige Kippung. Hauptsächlich wegen der Anhydrit-Subrosion im Untergrund stürzen in großen Zeitabständen schmale, hohe Felsschollen ab oder rutschen den Steilhang - mangels eines Widerlagers an ihrem Fußpunkt - herab. Durch die andauernde Subrosion im "Werraanhydrit" im Untergrund des Schlossberges sackt dieser sehr langsam ab (vermutlich mit Beträgen von einigen mm / Jahrzehnt). Jedoch können einzelne Dolomitschollen, z. B. durch Einsturz einer Höhle, unregelmäßig einstürzen.
Die zahllosen senkrechten Klüfte im Schlossbergsporn leiten viel Niederschlagswasser in den Berg hinein. Dies gilt auch für jene Spalten, die durch Erdreich oder lockere Aufschüttungen im Schlosshof oder um das Schloss herum verdeckt sind. Solche Sickerwässer fördern dabei in einem sich sehr langsam selbst verstärkenden Prozess das Fortschreiten der Verkarstung.
Quelle: www.Karstwanderweg.de; wikipedia.de; Infotafeln vor Ort
Happy Hunting wünschen